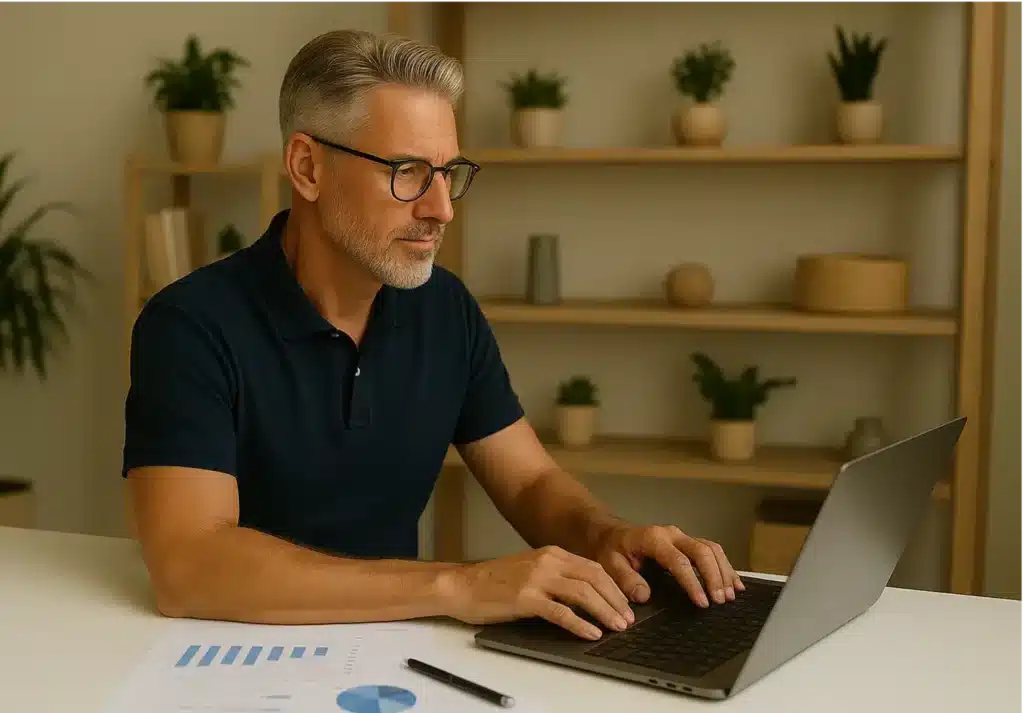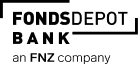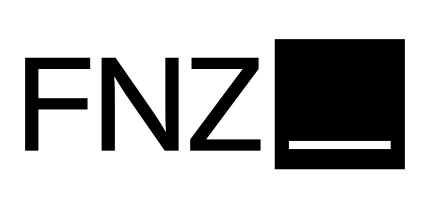|
Wiedergabe
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Geldvermögen, Strukturwandel und Chancen für Anleger im Überblick
Deutschland steht 2025 vor einer komplexen wirtschaftlichen Lage – mit Rekorden beim Geldvermögen, anhaltender Rezession und tiefgreifenden Strukturveränderungen. Gleichzeitig ergeben sich neue Möglichkeiten für Anleger, insbesondere durch gezielte Fondsstrategien. Wer die Entwicklungen kennt, kann sein Kapital gezielt ausrichten – auch mit Unterstützung durch erfahrene Partner wie PROfinance.
Rekord-Geldvermögen trotz Krisen
Mit 9,3 Billionen Euro erreichte das Geldvermögen deutscher Haushalte 2024 ein neues Rekordniveau – ein Anstieg von fast 6 %. Haupttreiber waren die hohe Sparquote von 11,5 % sowie Kursgewinne an den Aktienmärkten. Dies zeigt: Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt das Vertrauen in den Vermögensaufbau hoch.
Für 2025 wird ein weiterer Anstieg um 4 % auf 9,8 Billionen Euro erwartet. Dabei gewinnen Aktien und verzinste Bankeinlagen wieder an Bedeutung. Allein die Zinseinnahmen kletterten 2024 auf 30 Milliarden Euro.
Drei Jahre Rezession – deutsche Wirtschaft unter Druck
Die deutsche Wirtschaft steckt in der längsten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Nach einem Rückgang von 0,3 % (2023) und 0,2 % (2024) ist auch für 2025 ein Minus zu erwarten. Ursachen sind die Nachwirkungen von Pandemie, Energiekrise und Inflation, verbunden mit einer geringen Investitionsbereitschaft.
Vor allem Industrieunternehmen planen laut DIHK, ihre Investitionen zurückzufahren. Langfristige Risiken wie die Abhängigkeit vom Welthandel und fehlende Reformen bremsen zusätzlich.
Arbeitsmarkt im Wandel
Erstaunlich: Trotz Krise stieg die Zahl der Erwerbstätigen 2024 auf ein Rekordhoch von 46,1 Millionen. Wachstumsimpulse kamen vor allem aus dem Dienstleistungssektor und durch Zuwanderung. Parallel verloren Bau und Industrie deutlich an Beschäftigung.
Für 2025 rechnen Experten mit einem moderaten Rückgang der Beschäftigung, vor allem in traditionellen Branchen. Gleichzeitig könnten zukunftsträchtige Industrien wie Luftfahrt, Biotech oder Robotik neue Jobs schaffen.
Die Bauwirtschaft in der Dauerkrise
Die Bauwirtschaft erlebt das fünfte Jahr ohne Wachstum. Besonders der Tiefbau leidet unter kommunalen Haushaltskürzungen. Das kommunale Defizit verdoppelte sich 2024 auf 13 Milliarden Euro, was viele Investitionsprojekte gefährdet.
Im Wohnungsbau bleibt die Nachfrage hoch, doch steigen Materialkosten und Fachkräftemangel bleiben zentrale Herausforderungen.
Strukturelle Herausforderungen nehmen zu
Langfristig gefährden Bildungslücken, demografischer Wandel und ein mangelnder Umgang mit neuen Technologien die Wettbewerbsfähigkeit. Jährlich verlassen etwa 400.000 Erwerbstätige altersbedingt den Arbeitsmarkt – Nachwuchs fehlt.
Zudem entstehen durch KI und Automatisierung neue Anforderungen an Qualifikation. Viele einfache Tätigkeiten entfallen, während Fachkräfte in IT, Technik und Pflege dringend gesucht werden.
Globale Unsicherheiten belasten zusätzlich
Auch geopolitische Spannungen und Energieabhängigkeiten prägen das Bild. Steigende US-Zölle oder Engpässe bei Energieimporten könnten die Erholung weiter verzögern. Deutschland bleibt anfällig für sogenannte „Dunkelflauten“ – wind- und sonnenarme Zeiten mit teurem Strombezug.
Ihr bestehendes Depot clever optimieren – mit PROfinance
Wenn Sie bereits ein Depot bei einer unserer Partnerbanken führen – z. B. comdirect, FFB, FNZ/ebase, Fondsdepot Bank oder DAB BNP Paribas – können Sie per kostenfreiem Betreuerwechsel zu PROfinance wechseln. Ihr Depot bleibt bestehen, Sie erhalten jedoch unsere Sonderkonditionen, bis zu 99 % Rückvergütung und professionellen Support.
✔ Bis zu 99 % Rückvergütung der Bestandsprovision
✔ Keine Ausgabeaufschläge – volle Transparenz
✔ Depot bleibt bestehen – nur der Betreuer ändert sich
✔ Digitales Kundenportal & Web-App für Depot-Übersicht & Verwaltung
✔ Treueprämie ab 10.000 € Depotvolumen
✔ Exklusives Bonusprogramm ab 50.000 € Fondsvolumen – allein oder im Team
Der Wechsel ist einfach, schnell und kostenfrei – Sonderkonditionen gelten auch für neue Depots mit Fondsübertrag, falls Ihr Depot noch bei einer anderen Bank, wie zum Beispiel der ING, Volksbank, Sparkasse oder Deutschen Bank gelagert ist.
Fondsstrategien für strukturelle Umbrüche
Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche können Anleger von breit gestreuten Themenfonds profitieren. Diese bündeln gezielt Chancen in Bereichen wie erneuerbare Energien, Gesundheit, Infrastruktur oder Technologie. Wer frühzeitig investiert, partizipiert an langfristigen Wachstumsstorys.
Auch Megatrends wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel bieten Ansatzpunkte für nachhaltige Investmentstrategien – besonders interessant für langfristig orientierte Fondsanleger.
Fazit: Risiken aktiv begegnen, Chancen nutzen
Deutschland 2025 ist ein Jahr der Gegensätze: Auf wirtschaftliche Unsicherheit treffen Rekordvermögen, Innovationskraft und Beschäftigungswachstum. Wer strategisch investiert und sein Depot optimiert, kann die Risiken abfedern und Chancen gezielt nutzen – besonders durch fondsbasierte Lösungen mit starken Partnern.
Unser Tipp: Jetzt Weichen für die Zukunft stellen
Nutzen Sie den Moment, um Ihre Finanzstrategie an die neuen wirtschaftlichen Realitäten anzupassen. Eine gut strukturierte Depotlösung mit Fokus auf zukunftsträchtige Themen kann langfristige Vorteile sichern – insbesondere durch professionelle Begleitung.
FAQ – Häufige Fragen zur Wirtschaft 2025
Wie sicher ist das Geldvermögen deutscher Haushalte 2025?
Die steigende Sparquote zeigt, dass viele Deutsche trotz Krisen auf Sicherheit setzen. Durch breite Streuung und strategische Anlageformen kann das Risiko weiter minimiert werden.
Welche Branchen bieten 2025 Wachstumspotenzial?
Vor allem zukunftsorientierte Sektoren wie Gesundheit, Luftfahrt, Technologie und erneuerbare Energien gelten als Wachstumstreiber. Themenfonds bündeln hier gezielt Chancen.
Welche Vorteile bietet ein Depotwechsel zu PROfinance?
Bei einem Wechsel zu PROfinance profitieren Sie von Rückerstattungen, keine Ausgabeaufschläge, digitalem Kundenportal und persönlichem Support – bei gleichbleibender Depotstruktur.